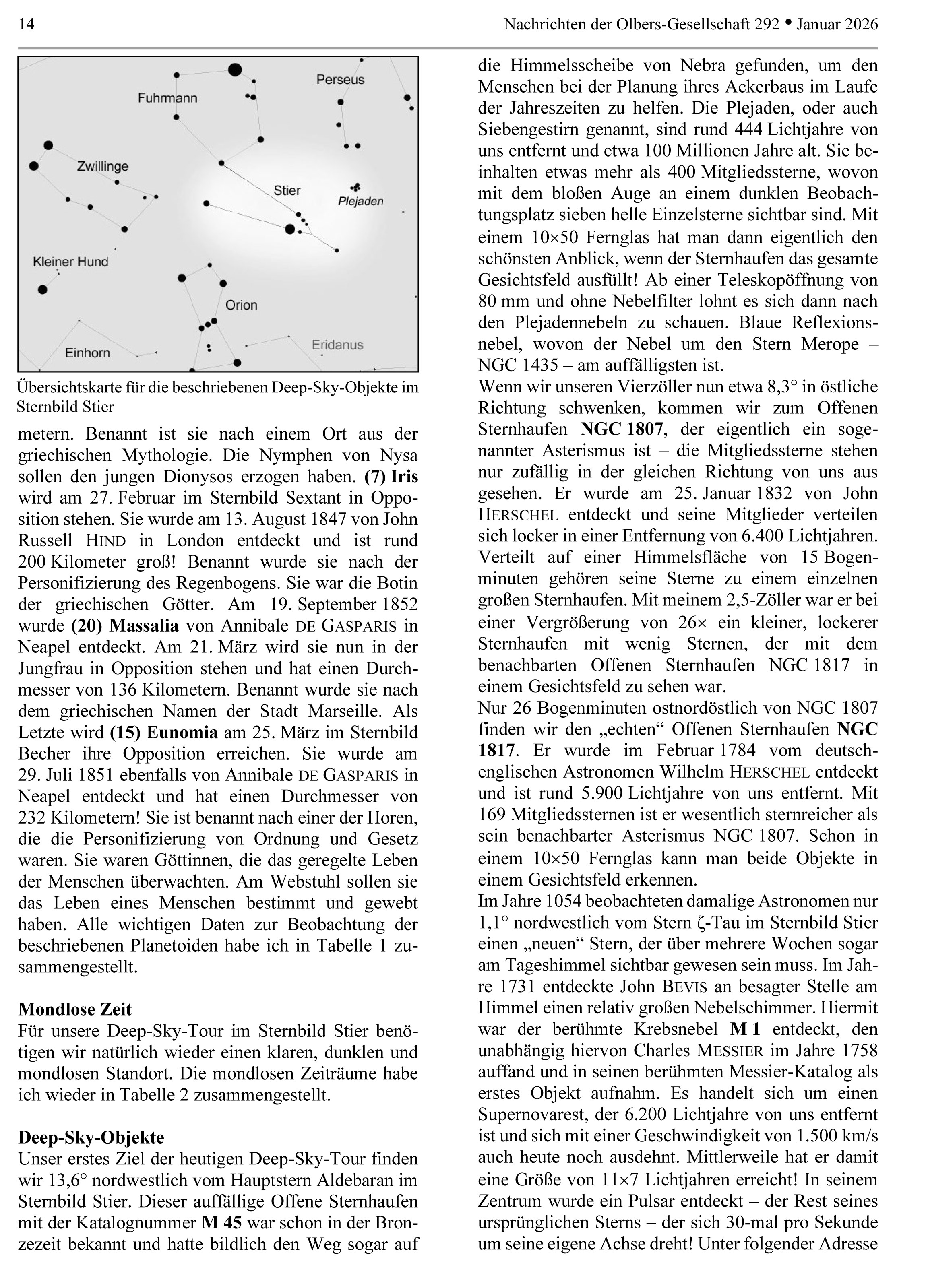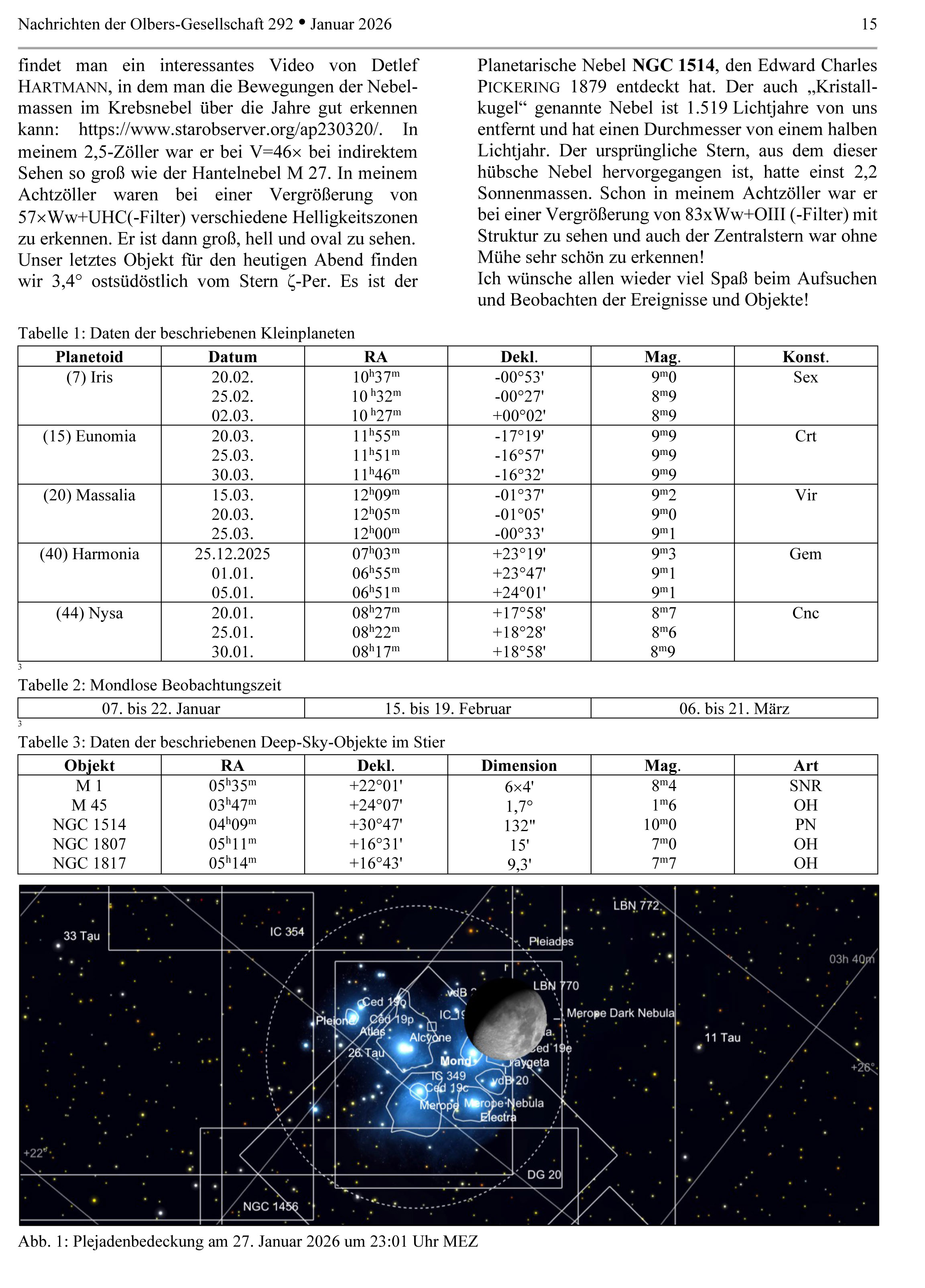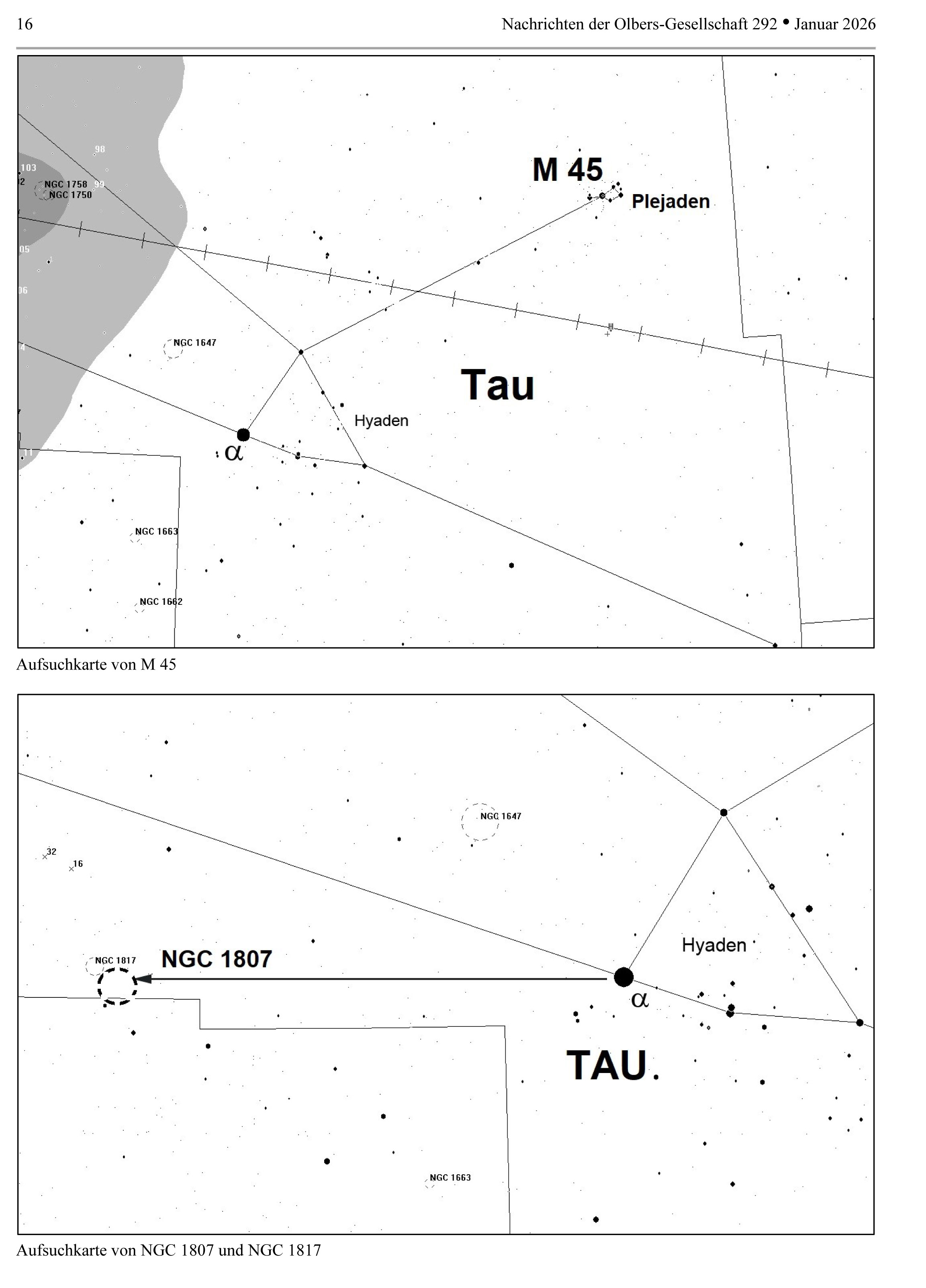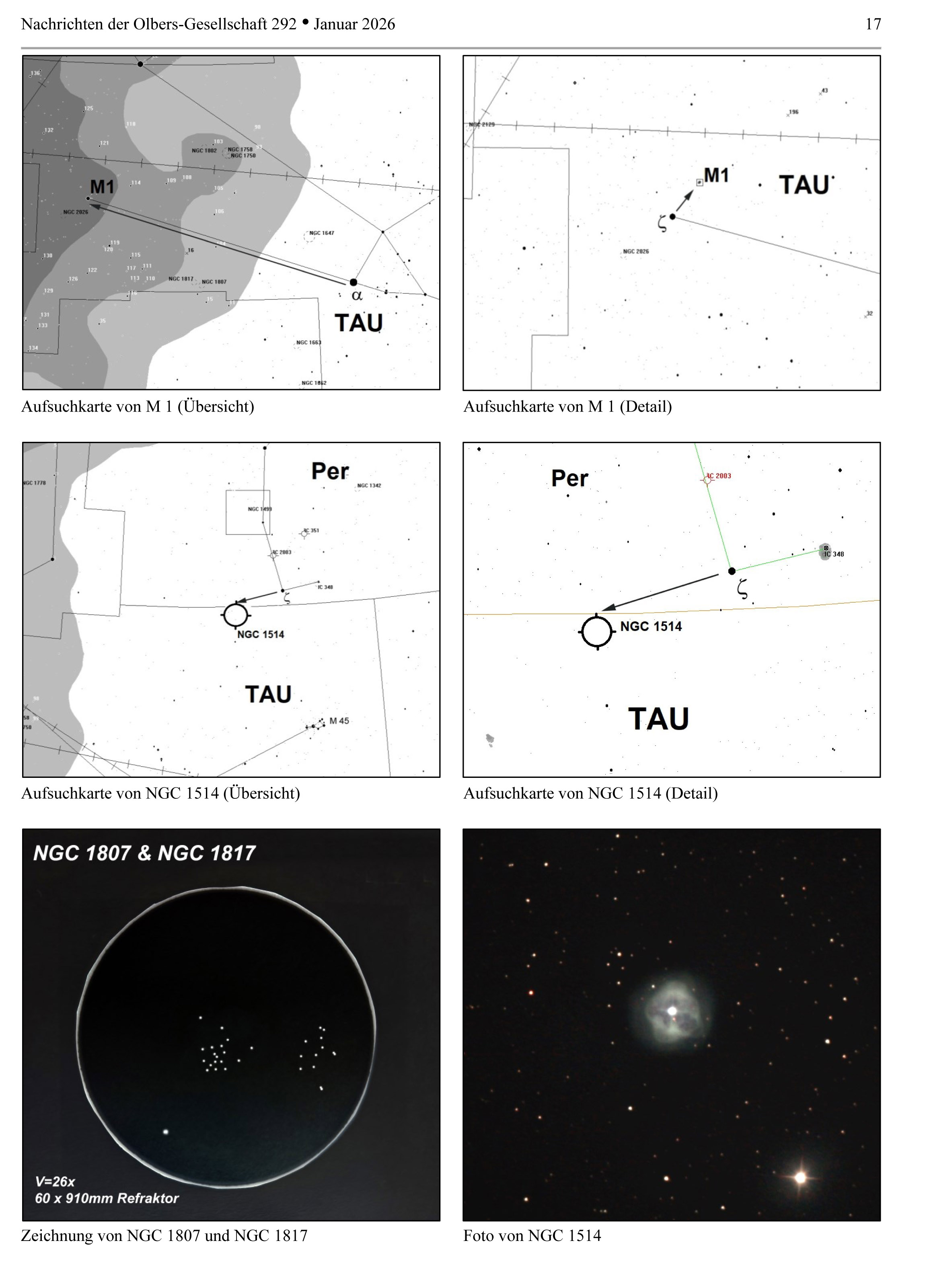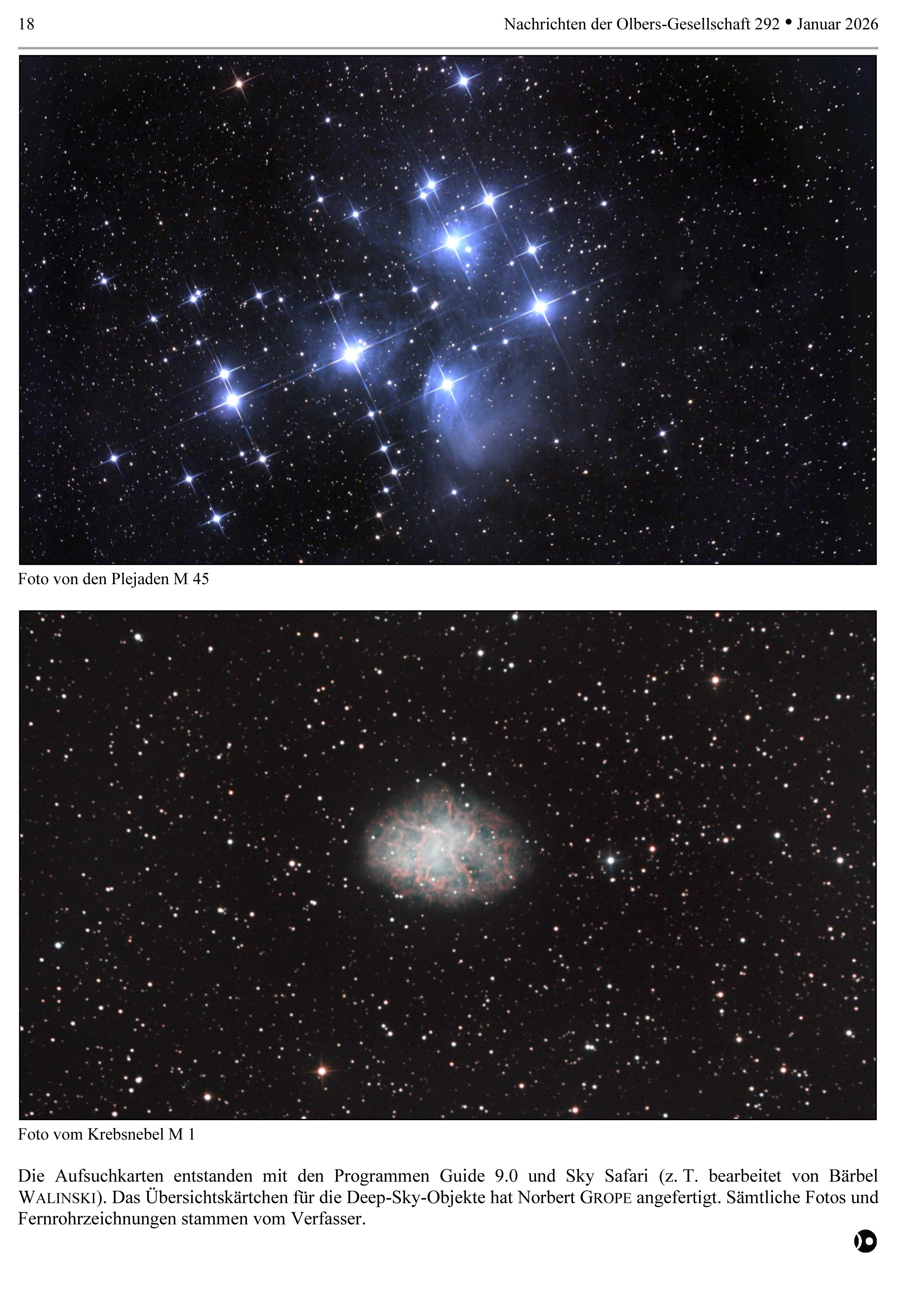Falls Sie hier den Link zu CalSky vermissen: CalSky ist seit Oktober 2020 leider offline.
Alternativ empfehlen wir die Web-Version von Stellarium.
(Stellarium ist ein Planetariumsprogramm, welches Ihnen für Ihren Standort den Sternenhimmel zeigt.)
Es folgen Beobachtungstipps für das 1. Himmelsquartal als Auszug aus den Olbers-Nachrichten.